Krankenhausreinigung und Reinigungsmanagement
Facility Management: Gebäudereinigung » Reinigungsmanagement » Reinigungsarten » Krankenhausreinigung
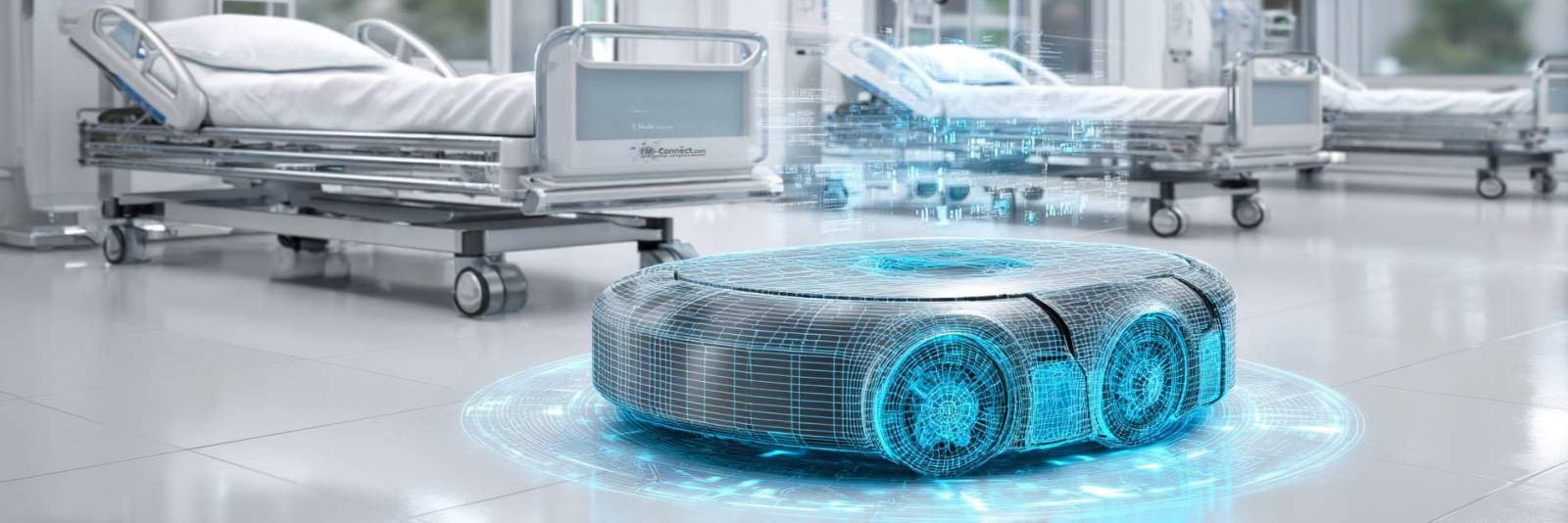
Krankenhausreinigung und Reinigungsmanagement
Krankenhaushygiene und Sauberkeit stehen im Gesundheitswesen an oberster Stelle, denn sie tragen maßgeblich zur Vermeidung von Krankenhausinfektionen (nosokomialen Infektionen) bei. Dennoch gab es in Deutschland lange Zeit keinen einheitlichen Standard für die Krankenhausreinigung. Jährlich erwerben sich in Deutschland schätzungsweise 400.000 bis 600.000 Patienten eine Infektion im Krankenhaus, und etwa 10.000 bis 20.000 Menschen versterben daran. Probleme wie multiresistente Erreger, mangelnde Compliance bei Reinigungsplänen und Kostenrestriktionen führen zu suboptimalen Reinigungsergebnissen. Vor diesem Hintergrund wurde 2021 eine DIN-Norm für die Krankenhausreinigung (DIN 13063) veröffentlicht, die konkrete Anforderungen an Reinigungsprozesse und -ergebnisse in Krankenhäusern festlegt.
Trotz aller Normen und Technologien bleibt die Krankenhausreinigung ein „People Business“. Die Beschäftigten an der Basis, die Reinigungskräfte, leisten Schwerstarbeit, oft im Verborgenen und leider nicht immer mit der Anerkennung, die ihnen gebührt. Es ist Aufgabe des Managements, hier eine Kultur der Wertschätzung und Integration zu schaffen, denn nur engagierte, geschulte Mitarbeiter können die hohen Anforderungen erfüllen. Ein makellos sauberes Krankenhaus wird mehr denn je als Indikator für Qualität gesehen werden. „Hygiene ist Teamarbeit“. Die Krankenhausreinigung ist ein Schlüsselfaktor, aber sie wirkt nie isoliert. Erfolg entsteht, wenn Management, Hygienefachleute, Pflege, Ärzte und Reinigungskräfte Hand in Hand arbeiten, gemeinsame Ziele verfolgen und sich gegenseitig respektieren. „Ein sauberes Krankenhaus ist ein sicheres Krankenhaus.“
Rechtliche und normative Grundlagen
- Rechtliche
- Organisation
- Reinigungskategorien
- Qualifikation
- Qualitätssicherung
- Wirtschaftlichkeit
- Nachhaltigkeit
normative Grundlagen
Ein umfassendes Verständnis der Krankenhausreinigung erfordert zunächst die Betrachtung des rechtlichen Rahmens sowie einschlägiger Normen und Richtlinien in Deutschland. Die gesetzlichen Vorgaben legen fest, wer wofür verantwortlich ist und welche Mindeststandards einzuhalten sind. Darauf aufbauend konkretisieren Normen, Leitlinien und Empfehlungen die Standards der Technik und „Stand des Wissens“ für die Reinigungs- und Hygienepraxis im Krankenhaus.
Infektionsschutzgesetz und Hygieneverordnungen
Zentraler Pfeiler ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG). Gemäß § 23 IfSG ist die Leitung jeder Gesundheitseinrichtung (z.B. Krankenhaus) verpflichtet, sicherzustellen, „dass die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern […] zu vermeiden.“. Diese allgemeine Pflicht umfasst implizit auch eine sachgerechte Reinigung und Desinfektion aller relevanten Flächen, da diese Maßnahmen nach medizinischem Standard zur Infektionsprävention erforderlich sind. In Umsetzung des IfSG haben alle Bundesländer Krankenhaushygieneverordnungen erlassen, die u.a. die Erstellung von Hygieneplänen vorschreiben. In jedem Krankenhaus muss ein aktueller Hygieneplan vorliegen, der unter anderem Reinigungs- und Desinfektionsstandards für alle Bereiche regelt (z.B. Reinigungsintervalle, einzusetzende Mittel, Verfahren). Die Hygienekommission des Hauses – unter Beteiligung von Krankenhaushygienikern und Hygienefachkräften – überwacht die Umsetzung und Weiterentwicklung dieser Hygienevorgaben. Damit bildet das IfSG den gesetzlichen Rahmen, innerhalb dessen sich das Reinigungsmanagement bewegen muss. Verstöße (etwa systematisch unzureichende Hygiene) können im Ernstfall behördliche Anordnungen oder sogar Betriebsschließungen nach sich ziehen (§§ IfSG). Zudem bestehen Meldepflichten bei Auftreten bestimmter Infektionen oder Ausbrüchen, was einen indirekten Druck erzeugt, die präventiven Hygienemaßnahmen – einschließlich Reinigung – konsequent umzusetzen.
Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250)
Neben dem Infektionsschutz der Patienten regelt der Gesetzgeber auch den Arbeitsschutz des Reinigungspersonals im Umgang mit biologischen Gefahrenstoffen. Die Biostoffverordnung (BioStoffV) und insbesondere die Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe 250 (TRBA 250) „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ enthalten verbindliche Vorgaben zum Schutz der Beschäftigten vor Infektionsgefährdungen. Reinigungsarbeiten im Krankenhaus werden dabei je nach Infektionsrisiko verschiedenen Schutzstufen zugeordnet. So gelten Routine-Reinigungen in allgemein gepflegten Bereichen (z.B. auf Normalstationen, Verwaltungsbereichen) in der Regel als Schutzstufe 1 (geringes Risiko). Demgegenüber wird z.B. die Reinigung eines OP-Saals mit Kontamination durch Blut der Schutzstufe 2 (erhöhtes biologisches Risiko) zugeordnet, was strengere Schutzmaßnahmen erfordert. Tätigkeiten mit hohem Infektionsrisiko (etwa Aufbereitung hochinfektiöser Isolationsbereiche oder spezielle Laborreinigungen) können unter Schutzstufe 3 fallen.
Die TRBA 250 fordert für alle Tätigkeiten eine Gefährdungsbeurteilung und darauf basierend Schutzmaßnahmen. Dazu zählen u.a. das Tragen geeigneter Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) – z.B. flüssigkeitsdichte, reißfeste Schutzhandschuhe mit langem Schaft für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten, um ein Unterlaufen kontaminierter Flüssigkeiten zu verhindern. Weiterhin müssen Arbeitgeber Schulungen zur Hautschutz-, Reinigungs- und Pflege bereitstellen und überwachen, da Feuchtarbeit (ständiges Arbeiten mit nassen Handschuhen/Lösungen) die Haut belastet. In der TRBA 250 wird explizit auf den Vorrang der Desinfektion vor der Reinigung bei infektiösem Material hingewiesen, um die Erregerlast vor mechanischer Reinigung möglichst zu reduzieren. Die Ausstattung muss geeignet und leicht zu reinigen/desinfizieren sein (z.B. wischbare Oberflächen für Reinigungsgeräte). Zudem fordert die TRBA die Erstellung arbeitsbereichsspezifischer Hygienepläne mit Regelungen zu Desinfektion, Reinigung, Sterilisation sowie Ver- und Entsorgung; diese müssen sowohl dem Arbeitsschutz (§§ 9, 11 BioStoffV) als auch dem Patientenschutz (§§ 23, 36 IfSG) gerecht werden. Praktisch bedeutet dies, dass z.B. im Hygieneplan klar festgelegt sein muss, in welchen Bereichen welche Schutzstufe gilt und welche Schutzmaßnahmen die Reinigungskräfte dort einzuhalten haben (z.B. separate Schutzkleidung in Isolationsbereichen, Impfangebote wie Hepatitis B für Reinigungspersonal etc.). Arbeitgeber sind verantwortlich, die Einhaltung dieser Maßnahmen zu kontrollieren und bei Bedarf anzupassen. Somit stellt TRBA 250 sicher, dass die Krankenhausreinigung nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Mitarbeiter sicher gestaltet wird.
RKI-Richtlinien und KRINKO-Empfehlungen
Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) am Robert Koch-Institut gibt evidenzbasierte Empfehlungen heraus, die quasi als anerkannter Stand der Wissenschaft für Hygienemaßnahmen gelten. Bereits 2004 veröffentlichte die KRINKO eine Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ (Bundesgesundheitsblatt 2004). Darin wurden u.a. Kriterien für die Reinigungshäufigkeit und den Differenzierten Desinfektionseinsatz festgelegt. Zum Beispiel empfahl die KRINKO 2004, patientennahe Flächen in definierten Risikobereichen routinemäßig wischdesinfizierend zu reinigen, während in Low-Risk-Bereichen eine gründliche Reinigung (ohne Desinfektionsmittel) ausreichen könne – es sei denn, es liegt eine Kontamination oder ein Ausbruchsereignis vor. Diese Empfehlung zielte darauf ab, ein einheitliches Mindestniveau der Flächenhygiene sicherzustellen und Überdesinfektion zu vermeiden. Die Umsetzung war allerdings fakultativ; Erhebungen zeigten eine variable Praxis in den Kliniken: 48 % der Häuser gaben 2013 an, genau entsprechend der KRINKO-Empfehlung desinfizierend zu reinigen, während 35 % grundsätzlich immer mit Desinfektionsmittel reinigen (auch über die Empfehlung hinaus) und 17 % weniger desinfizierend reinigen als vorgegeben. Diese Diskrepanz unterstreicht die Herausforderung, freiwillige Leitlinien flächendeckend in die Praxis zu überführen.
Im September 2022 hat die KRINKO die Flächen-Empfehlung grundlegend aktualisiert (Bundesgesundheitsbl. 65, S.1074–1115) und an neueste Erkenntnisse angepasst. Die neue KRINKO-Richtlinie 2022 differenziert klar zwischen Basishygiene (Routineflächenreinigung/-desinfektion im Normalbetrieb) und Situationshygiene (erhöhte Maßnahmen bei Isolationspatienten, Ausbrüchen etc.). Sie betont, dass eine adäquate personelle und materielle Ausstattung Grundvoraussetzung für qualitätsgerechte Reinigung ist. Außerdem werden moderne Verfahren (z.B. validierte Sichtkontrollen, Marker-Tests zur Überprüfung der Reinigungsleistung) und Schulungskonzepte hervorgehoben. Insgesamt stellen die KRINKO-Empfehlungen für Krankenhäuser eine wichtige Richtschnur dar, an der sie ihre hauseigenen Hygienepläne ausrichten müssen. Zwar haben die KRINKO-Leitlinien keinen Gesetzesstatus, doch werden Abweichungen im Schadensfall oder bei Begehungen durch Aufsichtsbehörden kritisch hinterfragt.
DIN-Normen und fachliche Standards
Bis vor kurzem existierten – im Gegensatz zu Bereichen wie Aufbereitung von Medizinprodukten – keine DIN-Normen speziell für Reinigungsleistungen im Krankenhaus. Die Praxis orientierte sich an den genannten KRINKO-Empfehlungen, den technischen Regeln (TRBA, UVV) sowie an brancheninternen Standards (z.B. Qualitätskriterien der Gütegemeinschaft Reinigung). Dies änderte sich mit der Einführung der DIN 13063 „Krankenhausreinigung – Anforderungen an die Reinigung und desinfizierende Reinigung in Krankenhausgebäuden und anderen medizinischen Einrichtungen“. Diese Norm wurde von über 40 Experten aus Wissenschaft, Hygiene, Wirtschaft und Verbänden erarbeitet und im November 2021 veröffentlicht. DIN 13063 definiert erstmals einen einheitlichen Reinigungsstandard für deutsche Krankenhäuser und konkretisiert, welche Anforderungen an Reinigungsprozesse und -ergebnisse gestellt werden.
Besonderer Wert wird in der Norm auf eine strukturierte Organisation, qualifiziertes Personal, geeignete Verfahren und regelmäßige Kontrollen gelegt. So adressiert DIN 13063 Anforderungen sowohl an den Auftraggeber (Krankenhaus/FMdienst) – z.B. baulich-organisatorische Rahmenbedingungen, ausreichende Personalausstattung – als auch an den Auftragnehmer (Reinigungsdienstleister oder interne Abteilung) hinsichtlich Sachkunde des Personals, Ausrüstung und Prozessgestaltung. Es werden Standardvorgaben für die Unterhaltsreinigung verschiedener Bereichstypen gemacht, inklusive Art, Umfang und Häufigkeit der Reinigung bzw. Desinfektionsreinigung je nach Raumgruppe. Konkret enthält die Norm ein Leistungsverzeichnis definierter Raumgruppen, das z.B. festlegt, welche Flächen in welchen Bereichen wie oft gereinigt bzw. desinfizierend gereinigt werden sollen. Ebenso beschreibt die Norm geeignete Verfahren (Wischmethode, Ein- oder Zweistufenverfahren, Einsatz von Reinigungsautomaten etc.) und gibt Hinweise zur materiellen Ausstattung (etwa Farbcode-Systeme für Putzlappen, Gebrauch von Einweg- oder Mehrwegtextilien, Eigenschaften von Reinigungsgeräten). Auch Schulungen und Kontrollmechanismen werden betont: So sollen Reinigungskräfte verstärkt mit Bildern und Piktogrammen angeleitet werden und regelmäßige Unterweisungen erhalten; zudem ist eine systematische Qualitätskontrolle durch Sichtprüfungen oder Messverfahren vorgesehen. Nicht zuletzt gibt DIN 13063 Hinweise zur öffentlichen Ausschreibung von Reinigungsdienstleistungen, um bei Vergaben Qualitätskriterien zu verankern und Vergleichbarkeit zu schaffen.
DIN 13063 schließt damit eine Lücke und unterstützt all jene, die für die Einhaltung von Hygienestandards verantwortlich sind. Allerdings handelt es sich um keine zertifizierungspflichtige Norm – d.h. Krankenhäuser können (müssen aber nicht) ihre Reinigung danach ausrichten, ohne dass eine externe Stelle die Konformität prüft. Experten begrüßen zwar die Inhalte der Norm, befürchten aber, dass ohne ein Audit- oder Zertifizierungssystem die Umsetzung lückenhaft bleiben könnte (vgl. Meyer, 2021, sinngemäß „Norm ohne Zertifizierung ist ein zahnloser Tiger“). Gleichwohl ist DIN 13063 ein wichtiger Meilenstein hin zu mehr Standardisierung und Transparenz in der Krankenhausreinigung.
Ergänzend zur DIN 13063 gibt es weitere Normen und Richtlinien, die tangierende Aspekte behandeln. Beispielhaft sei die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen in Schulgebäuden) genannt, die bereits 2015 Mindestanforderungen an die Schulreinigung formulierte – allerdings ohne große Verbreitung. Für Krankenhäuser relevant sind zudem Normen zu Reinigungsgeräten (z.B. DIN EN 13549 zur Qualitätsmessung in der Gebäudereinigung) sowie Veröffentlichungen von Fachverbänden. Die Gütegemeinschaft Gebäudereinigung vergibt z.B. das RAL-Gütezeichen 902 an Reinigungsunternehmen, die definierte Qualitätskriterien einhalten. Speziell für den Gesundheitswesen-Bereich existiert das RAL-GZ 903, das objektbezogen ein hohes Hygieneniveau in Kliniken bescheinigen kann. Solche Zertifikate sind freiwillig, können aber im Qualitätsmanagement eines Krankenhauses eine Rolle spielen.
Es bilden IfSG und Länderverordnungen die rechtliche Grundlage, TRBA 250 & Arbeitsschutzvorgaben schützen die Mitarbeiter, KRINKO/RKI-Empfehlungen und Leitlinien der Fachgesellschaften (DGKH, AWMF) definieren den fachlichen Standard, und die neue DIN 13063 liefert einen konkreten Maßstab für die operative Umsetzung und das Management der Krankenhausreinigung.
Organisation und Managementmodelle der Krankenhausreinigung
Die Organisation der Reinigung in Krankenhäusern ist ein komplexes Aufgabenfeld im Facility Management (FM), das sowohl infrastrukturelle Dienstleistungen als auch Hygieneverantwortung umfasst. Unterschiedliche Managementmodelle haben sich in der Praxis etabliert, je nach Größe des Hauses, strategischen Entscheidungen und historischen Entwicklungen. Im Wesentlichen lassen sich drei Modelle unterscheiden: interne Eigenreinigung, Tochtergesellschaft/Servicegesellschaft und Fremdvergabe an externe Reinigungsfirmen.
Eigenreinigung vs. Fremdvergabe
Bei der Eigenreinigung beschäftigt das Krankenhaus eigenes Reinigungspersonal direkt als Teil des Personalstamms. Dieses Modell bietet den Vorteil einer unmittelbaren Kontrolle über die Abläufe und Qualität. Die Reinigungskräfte sind dem Haus zugehörig, oft tarifgebunden bezahlt und stärker in die Krankenhausorganisation integriert. Sie identifizieren sich nicht selten mit „ihrer“ Station, was die Motivation und Verantwortungsübernahme fördern kann. In einem DGKH-Survey 2013 gaben allerdings nur noch 21 % der Krankenhäuser an, eine vollständig interne Reinigung zu betreiben. Hintergrund sind v.a. die hohen Personalkosten im öffentlichen Dienst und die wirtschaftlichen Zwänge der Kliniken.
Viele Häuser haben daher Servicegesellschaften (Tochterfirmen) gegründet, welche die Reinigungsleistung erbringen. Etwa 50 % der Krankenhäuser setzten 2013 auf solche Tochterunternehmen. Die Reinigungskräfte sind dann formal Angestellte der Service-GmbH, oft zu günstigeren Konditionen als im Kernkrankenhaus. Das Krankenhaus behält aber über Geschäftsführungsstrukturen und vertragliche Gestaltung erheblichen Einfluss. Dieses Modell versucht, die Vorteile der Eigenreinigung (Flexibilität, Qualitätssteuerung) mit den Kostenvorteilen einer ausgegliederten Einheit zu kombinieren. Allerdings ist zu beachten, dass bei solchen Ausgliederungen manchmal die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Haus leidet und Schnittstellenprobleme auftreten können (z.B. zwischen Pflegepersonal und ausgelagerten Reinigungskräften).
Die komplette Fremdvergabe an externe Reinigungsdienstleister stellt das dritte Modell dar (ca. 29 % der Kliniken praktizierten dies 2013). Hier wird in der Regel europaweit ausgeschrieben, und ein spezialisierter Dienstleister (Gebäudereinigungsfirma) übernimmt per Dienstleistungsvertrag die Reinigung. Vorteile sind eine klare Kostentransparenz, Nutzung von Skaleneffekten des Dienstleisters (z.B. bei Schulungen, Maschineneinsatz) und die Möglichkeit, bei Unzufriedenheit den Anbieter zu wechseln. Externe Firmen bringen oft Fach-Know-how mit und sind auf Effizienz getrimmt. Die Kehrseite ist jedoch die Abhängigkeit von der Qualität des Dienstleisters. Ohne gutes Vertrags- und Kontrollmanagement kann es zu Qualitätseinbußen kommen, da der preisgünstigste Anbieter nicht zwangsläufig der beste ist. Tatsächlich zeigte sich in einigen Kliniken nach Outsourcing zunächst eine Verschlechterung wahrgenommener Sauberkeit, was intensivere Kontrollen nach sich zog (Fallbeispiel siehe Kap. 11). Ein weiteres Thema ist die Personalfluktuation: Externe Firmen haben mitunter höhere Fluktuation, was die Kontinuität erschwert. Zudem berichteten nur ~20 % der externen Dienstleister, dass sie feste Reinigungsteams pro Station einsetzen; häufig rotieren die Kräfte flexibel. Das Fehlen fester Zuständigkeiten kann die Qualität beeinträchtigen, da ortskundige Routine fehlt.
Ein Sonderweg sind Mischmodelle: Einige Kliniken behalten z.B. intensiv hygienekritische Bereiche (OP, Intensivstationen) in Eigenregie, während weniger kritische Bereiche (Verwaltung, öffentliche Bereiche) fremdvergeben werden. So kann man die Stärken beider Ansätze kombinieren – allerdings erfordert das eine saubere Abgrenzung und doppelte Managementstrukturen.
Eingliederung ins Facility Management und Aufbauorganisation
Unabhängig vom gewählten Modell muss die Reinigung klar in die Organisation des Krankenhauses eingegliedert sein. In vielen Häusern ist die Krankenhausreinigung heute Teil des Facility Managements (FM) bzw. der Technik-/Serviceabteilung. Der Leiter der Hauswirtschaft oder Reinigung berichtet oft an den technischen Direktor oder FM-Leiter. Bei ausgelagerten Services gibt es typischerweise einen Objektleiter des Dienstleisters vor Ort, der mit der Krankenhausverwaltung koordiniert. Wichtig ist eine enge Abstimmung zwischen Reinigung, Pflege und Hygienefachkräften. Beispielsweise sollten Reinigungspläne so gestaltet sein, dass sie den Stationsablauf (Visiten, Patientenruhezeiten) berücksichtigen. Viele Krankenhäuser etablieren deshalb gemeinsame Teams oder Ausschüsse, in denen die Leitungen von Pflege, FM und Hygiene regelmäßig Qualitäts- und Ablaufprobleme der Reinigung besprechen.
Die Aufbauorganisation der Reinigungsdienste sieht häufig eine mehrstufige Hierarchie vor: An der Basis die Reinigungskräfte (oft in Vollzeit oder Teilzeit), darüber Vorarbeiter/Teamleiter (für definierte Bereiche oder Schichten verantwortlich) und an der Spitze ein objektverantwortlicher Leiter (Hausdienstleitung). In größeren Kliniken gibt es Bereichsleitungen (z.B. für OP-Reinigung separat, Intensivbereiche separat etc.). Diese Führungsstruktur ist entscheidend für die Kommunikation und Qualitätskontrolle. So meldet etwa eine Stationsleitung festgestellte Mängel an den zuständigen Vorarbeiter, der für Abhilfe sorgt und ggf. Schulungsbedarf weitergibt.
Feste Zuständigkeiten pro Bereich (z.B. eine bestimmte Reinigungskraft ist immer derselben Station zugeteilt) fördern die Verantwortlichkeit und lokalen Bezug. Allerdings haben Budgetkürzungen dazu geführt, dass fest zugeordnete Reinigungsmitarbeiter heute seltener sind – insbesondere externe Dienstleister setzen oft auf flexible Einsatzplanung. Während aus Managementsicht eine Pool-Lösung Personal effizienter auslastet (Stichwort Springerkräfte, Urlaubsvertretung), leidet darunter mitunter die Detailkenntnis (z.B. welche Patienten besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordern, wo typische „Problemstellen“ im Reinigungsobjekt sind). Einige Kliniken bemühen sich daher, zumindest Kernteams pro Station zu etablieren und Rotationen zu begrenzen.
Prozessorganisation und Schnittstellen
Die Organisation der Krankenhausreinigung umfasst auch die Gestaltung der Prozesse: Wann und wie werden die verschiedenen Bereiche gereinigt? Üblich ist ein Schichtbetrieb. Die Hauptreinigung erfolgt häufig in den frühen Morgenstunden (z.B. 6–10 Uhr), bevor der Tagesbetrieb voll startet. Während dieser Unterhaltsreinigung werden Patientenzimmer, Flure und Funktionsbereiche gemäß Plan gereinigt. Zusätzlich gibt es tagsüber Intervall- oder Bedarfsreinigungen (z.B. mehrfache Toilettenreinigung in Ambulanzen mit hohem Publikumsverkehr, OP-Zwischenreinigungen zwischen Operationen). Viele Krankenhäuser haben eine Nachmittags- oder Abendschicht für Aufbereitungen (z.B. OP nach Programmende, Intensivreinigung von Entlasszimmern) sowie Bereitschaftsdienste für akute Anforderungen (verschüttete Flüssigkeiten, Notfall-OP in der Nacht, Entbindung eines infektiösen Patienten etc.). In kleineren Häusern oder am Wochenende wird oft ein reduziertes Programm gefahren, z.B. nur die wichtigsten Bereiche täglich gereinigt und Sekundärbereiche im Intervall. Allerdings hat die COVID-19-Pandemie gezeigt, dass eine regelmäßige Reinigung auch an Wochenenden unabdingbar ist, sodass viele Kliniken hier nachjustiert haben.
Wesentlich für ein reibungsloses Zusammenspiel ist die Definition der Schnittstellen zwischen Reinigungspersonal und anderem Personal. Beispielsweise: Wer ist verantwortlich für das Aufräumen von Patientenzimmern (Persönliches wegräumen, Betten auseinanderziehen)? In vielen Hygieneplänen ist geregelt, dass die Pflege gewisse vorbereitende Maßnahmen trifft (z.B. benutzte Geschirre wegstellen, Patientenmobiliar halbwegs ordnen), damit die Reinigungskraft effizient arbeiten kann. Umgekehrt muss die Reinigung so arbeiten, dass medizinische Abläufe nicht gestört werden – etwa nicht wischen, während eine Visite oder eine Pflegemaßnahme läuft. Gute Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass Reinigungszeiten mit den Stationsteams abgesprochen sind und flexibel angepasst werden können.
Eine weitere Schnittstelle besteht zur Hygieneabteilung: Die Hygienefachkraft sollte eng mit der Reinigungsleitung zusammenarbeiten, etwa bei der Erstellung der Reinigungs- und Desinfektionspläne im Hygieneplan oder bei Schulungen des Reinigungspersonals in Hygienefragen. In manchen Häusern gibt es ein Konzept der „Hygienevisite“, bei der Hygieniker und Reinigungsvorgesetzte gemeinsam Stationen begehen, um den hygienischen Zustand inkl. Sauberkeit zu beurteilen.
Kommunikation spielt insgesamt eine Schlüsselrolle. Viele Kliniken etablieren feste Meldewege für Probleme: z.B. wenn dem Reinigungspersonal auffällt, dass bauliche Mängel (beschädigte Bodenbeläge, undichte Silikonfugen in Duschen) die Reinigung erschweren, sollte dies an FM/Technik weitergeleitet werden. Ebenso müssen ungewöhnliche Verunreinigungen (z.B. Schimmelbefall, Schädlingsspuren) vom Reinigungsdienst an die Hygiene/Störmelde-Stelle gemeldet werden.
Strategisches Management und Outsourcing-Steuerung
Auf strategischer Ebene muss das Krankenhaus entscheiden, wie Qualität, Kosten und Flexibilität der Reinigung austariert werden. Bei Outsourcing sind Leistungsverträge das zentrale Instrument: Ein detailliertes Leistungsverzeichnis definiert, was die Reinigungsfirma zu leisten hat. Zur Steuerung dienen Service-Level-Agreements (SLAs), die z.B. Sauberkeitsgrade oder Reaktionszeiten festlegen. Eine wichtige Managementaufgabe ist das Controlling der Dienstleistung: Hierzu gehören regelmäßige Besprechungen mit dem Dienstleister, Kennzahlen-Analysen (Reklamationsquote, Ergebnisse von Qualitätsaudits) und ggf. Vertragsstrafen oder Bonusregelungen bei Über-/Unterschreitung der vereinbarten Qualität.
Bei interner Reinigung liegen Steuerung und Verantwortung vollständig im Haus. Hier kommt es darauf an, dass die Reinigung in das Qualitätsmanagement-System des Krankenhauses eingebunden ist. Beispielsweise kann die Reinigung Teil der KTQ-Zertifizierung oder ISO 9001-Audits eines Krankenhauses sein, was eine kontinuierliche Dokumentation und Verbesserung verlangt. Einige Einrichtungen verfolgen Konzepte wie das „5S-Prinzip“ (aus dem Lean Management) auch im Reinigungsbereich, um Standards zu sichern.
Zusammenfassend variieren Organisations- und Managementmodelle je nach Klinik erheblich. Jede Variante hat Vor- und Nachteile: Eigenregie erlaubt hohe Kontrolle und Identifikation, birgt aber Kostendruck; Fremdvergabe kann Kosten senken, erfordert aber stringentes Qualitätsmanagement und birgt das Risiko von Schnittstellenproblemen. Wichtig ist, dass – ungeachtet des Modells – die Reinigung als integraler Bestandteil des Krankenhausbetriebes verstanden wird. Ein professionelles Reinigungsmanagement bedeutet daher, klare Strukturen, Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege zu schaffen, sodass Sauberkeit und Hygieneziele zuverlässig erreicht werden. Im nächsten Kapitel werden die spezifischen Reinigungskategorien und -anforderungen verschiedener Bereichsarten im Krankenhaus näher beschrieben, da diese die Grundlage für Planung und Organisation der Reinigung bilden.
Reinigungskategorien im Gebäudemanagement
Krankenhäuser umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Bereichsarten – von hochsensiblen OP-Sälen über Patientenzimmer bis hin zu Büros und Technikräumen. Diese Bereiche stellen jeweils spezifische Anforderungen an die Reinigung hinsichtlich Häufigkeit, Verfahren und notwendiger Desinfektionsmaßnahmen. In deutschen Kliniken hat es sich bewährt, verschiedene Reinigungskategorien zu definieren, um den Reinigungsprozess zu standardisieren. Die Norm DIN 13063 verweist in ihrem Leistungsverzeichnis auf eine Einteilung nach Raumgruppen, wie sie sinngemäß in der Branchensystematik DIN 276 oder im „Kennzahlenkatalog nicht-medizinischer Leistungen“ (LekaS) für Spitäler existiert.
Reinigungskategorien im Gesundheitswesen steuern
Reinigung der Bettenstation: Umfasst Patientenzimmer und zugehörige Stationsbereiche auf Normalpflegestationen. Anforderungen: Tägliche Unterhaltsreinigung aller belegten Zimmer und Sanitärbereiche, i.d.R. feuchtwischend. Schwerpunkt auf patientennahen Flächen (Nachttisch, Bettgestell, Tischplatten, Lichtschalter) und Fußboden. Desinfektionsmittel-Einsatz nach Hygieneplan, z.B. routinemäßig auf häufig berührten Flächen oder wenn Patienten mit übertragbaren Erregern vorliegen. Beispielverfahren: 2‑Eimer-Wischmethode mit Einmaltuchsystem.
Reinigung von intensivtherapeutischen Räumen (Intensivstation): Bereiche mit intensivmedizinischer Betreuung, oft mehrere Medizinprodukte und eingeschränkte Zugänglichkeit. Tägliche Wischdesinfektion aller Flächen ist hier Standard, da Patienten besonders infektionsanfällig sind. Erhöhte Anforderungen an Sauberkeit in Ecken, unter Geräten etc. Verfahren: Wischdesinfektion (meist alkohol- oder aldehydhaltig) bei kurzen Einwirkzeiten, um Kontaminationen z.B. mit MRSA/VRE zu reduzieren. Häufig engmaschigere Zwischenreinigungen (morgens, ggf. abends) und Sofortreinigung bei Bedarf (z.B. nach blutigen Eingriffen).
Reinigung von Operationsräumen (OP-Bereiche): Höchste Anforderungen an aseptische Bedingungen. Unterteilt in OP-Säle, Aufwachräume etc. Mehrstufiges Reinigungskonzept: Frühmorgendliche Grundreinigung aller OP-Säle (staubbindend wischen aller Böden, Flächen, Lampenarme etc.), Zwischenreinigung bzw. Aufbereitung nach jedem Eingriff (Entfernung von sichtbaren Kontaminationen, Wischdesinfektion von OP-Tisch, Böden unter dem Tisch, instrumentennahen Flächen) und eine Endreinigung nach Ende des Programms mit vollflächiger Desinfektion. Verwendung von geeigneten Desinfektionsmitteln (breites Wirkungsspektrum, schnell trocknend). OP-Reinigungskräfte oft speziell geschult. Häufig maschinelle Bodenreinigung (Scheuersaugmaschine) zur Steigerung der Reinigungswirkung auf großen Flächen, sofern praktikabel.
Reinigung des Kreißsaals (Geburtsbereich): Ähnelt in Anforderungen teilweise dem OP wegen möglicher Kontamination mit Blut/Fruchtwasser. Nach jeder Geburt: umfassende Desinfektionsreinigung von Gebärbett, Böden und Kontaktflächen. Tägliche Grundreinigung analog zu Intensiv. Besondere Beachtung: schonende Mittel (wegen Neugeborener), aber trotzdem wirksame Keimreduktion (v.a. bei möglicher Hepatitis, HIV in Geburtsumgebung).
Reinigung von therapeutischen Räumen, Aufnahme- und Notfallbereichen: Hierzu zählen Physio-/Ergotherapie-Räume, Endoskopie, Ambulanzen, Notaufnahme. Gemeinsam ist oft hoher Durchsatz verschiedener Patienten. Anforderungen: Tägliche Reinigung, in hochfrequentierten Aufnahmen ggf. mehrmals täglich (z.B. Aufnahmeräume nach jedem Patienten wischdesinfizieren, insbesondere Liegen). In Therapieräumen abhängig von Anwendungen – z.B. Desinfektion von Therapieliegen nach jedem Patienten, regelmäßige Gerätereinigung. Notaufnahmen erfordern flexible Sofortreinigung (Blut/Erbrochenes sofort entfernen und desinfizieren). Insgesamt Mischung aus Routineplänen und situativer Reinigung.
Reinigung von Bädern und Physikalischer Therapie: Dazu zählen z.B. Hydrotherapie-Bereiche, Bewegungsbäder, Saunen in Reha-Kliniken etc. Feucht-warme Umgebung begünstigt Keimvermehrung (z.B. Pseudomonaden), daher oft strengere Hygiene: z.B. tägliche Reinigung und Desinfektion der Beckenränder, Böden und Duschbereiche, regelmäßige Grundreinigungen (Entkalken, Biofilm-Entfernung). In physikalischer Therapie (Massage, Packungen) tägliche Reinigung der Liegen und Gerätschaften; Desinfektion nach jedem Patienten, wenn Hautkontakt (z.B. Elektroden, Auflageflächen).
Kategorie 1390.07 – Reinigung von Büroräumen und einfachen therapeutischen Räumen: Verwaltung, Arztzimmer, Besprechungszimmer, Personalräume, auch Funktionsräume mit geringem Patientenkontakt. Reinigung nach Nutzungsintensität, oft 2–3× pro Woche (Staubwischen, Bodenreinigung). Fokus auf sichtbarer Sauberkeit und Werterhalt. Keine routinemäßige Flächendesinfektion erforderlich, außer bei Kontamination. In Untersuchungszimmern ohne invasive Tätigkeiten ebenfalls primär Reinigung (ggf. gezielte Desinfektion bestimmter Flächen wie Tastaturen oder Telefonhörer nach Plan).
Reinigung von nicht-medizinischen Räumen mit hohem technischen Anspruch: Darunter fallen z.B. Serverräume, Elektrozentralen, Laborräume ohne Patientenkontakt (z.B. Techniklabore). Diese Räume erfordern oft spezielle Verfahren, etwa staubfreie Reinigung (IT-Serverräume: regelmäßiges Staubsaugen mit HEPA-Filter, feuchtes Wischen nur bei abgestellter Hardware) oder Einhaltung von ESD-Schutz. Medizinisch spielen sie für Infektionsrisiko kaum eine Rolle, aber Staub kann Geräte beschädigen. Reinigungsintervalle hier oft seltener (wöchentlich oder monatlich), jedoch sehr sorgfältig.
Reinigung von allgemeinen Verkehrsflächen: Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Wartebereiche. Anforderungen: Regelmäßige Unterhaltsreinigung nach Publikumsaufkommen – Hauptflure und Lobby in großen Kliniken oft täglich, Nebenflure evtl. alle 2 Tage. Verwendung von Reinigungsmaschinen (Scheuersaugmaschinen) für Effizienz auf großen Flächen ist üblich. Besonderes Augenmerk auf Rutschsicherheit (Böden trocknen schnell) und Ästhetik, da diese Bereiche Visitenkarte des Hauses sind. Bei Schmutzeintrag (Regen, Herbstlaub) ggf. erhöhter Reinigungsrhythmus. Keine Desinfektion außer bei z.B. Erbrochenem Unfall.
Reinigung von Technikräumen und Werkstätten: Hierzu zählen Heizungsräume, Lüftungszentralen, Werkstätten der Haustechnik, Lager. Diese Bereiche sind i.d.R. nicht täglich zu reinigen, sondern nach Bedarf oder festem Intervall (z.B. monatliche Grundreinigung). Wichtig: Grobschmutzbeseitigung, Staubentfernung zur Instandhaltung der Anlagen. Oft übernimmt die Technikabteilung oder ein separater Reinigungsplan diese Aufgaben. Hygiene spielt untergeordnet eine Rolle (keine Patienten). Es geht v.a. um Arbeitssicherheit (kein Brandlast durch Staub, kein Ausrutschen) und Werterhalt.
Reinigung von Außenflächen und Zuwegungen: Außenanlagen, Parkplätze, Zuwege, Hubschrauberlandeplatz etc. Hier handelt es sich um Geländereinigung (Laubkehren, Winterdienst mit Schnee- und Eisbeseitigung, Reinigung von Wegen/Müllbehältern). Diese Tätigkeiten fallen oft saisonal an und werden teilweise an Hausmeisterdienste oder externe Firmen vergeben. Im Hygiene-Kontext sind Außenanlagen weniger kritisch, jedoch tragen saubere Eingangsbereiche zum Gesamteindruck bei. Außerdem wichtig: Schädlingsprävention durch Sauberkeit (kein offener Müll, regelmäßige Hofreinigung).
Diese Reinigungskategorien dienen dazu, klare Anforderungen und Leistungsbeschreibungen zu formulieren. Sie werden typischerweise im Leistungsverzeichnis einer Reinigungsausschreibung oder im internen Hygieneplan aufgeführt. Für jede Kategorie sind folgende Punkte zu definieren: Reinigungsintervalle (wie oft pro Tag/Woche), Reinigungsmethode (trocken, feucht, desinfizierend), ggf. spezielle Reinigungsmittel (z.B. alkoholisches Desinfektionsmittel in OP, neutrales Reinigungsmittel in Büros), Personalqualifikation (sensible Bereiche nur von geschultem Personal) und Dokumentationspflichten (z.B. Reinigungsnachweis im OP-Buch).
Die Differenzierung ermöglicht eine ressourceneffiziente Planung – etwa damit nicht Büroräume unnötigerweise täglich desinfiziert werden, während ein Intensivzimmer entsprechend mehr Aufwand erfordert. Gleichzeitig stellt sie sicher, dass in kritischen Bereichen keine Kompromisse bei Häufigkeit und Gründlichkeit gemacht werden. So wird z.B. für Kategorie 03 (OP) in Norm und Empfehlungen klar vorgegeben, dass zwischen jedem Eingriff definierte Reinigungsmaßnahmen zu erfolgen haben. Für niedrigere Kategorien (z.B. Büros) kann man dagegen mit längeren Intervallen auskommen, was Personal einspart, ohne die Patientensicherheit zu gefährden.
Zusätzlich zu dieser räumlichen Kategorisierung gibt es noch das Konzept der hygienischen Risikoklassen (A, B, C…), das v.a. von der KRINKO verwendet wird: „A“ = kein direkter Patientenkontakt (nur Reinigung nötig), „B“ = patientennahe Bereiche ohne invasive Tätigkeiten (Reinigung, ggf. gezielte Desinfektion), „C“ = Risikobereiche mit hohen Anforderungen (regelmäßige Desinfektion). Diese Konzepte überschneiden sich weitgehend mit obigen Kategorien und fließen meist in die Reinigungsvorgaben ein.
Insgesamt schafft die Einteilung nach Kategorien eine Struktur, anhand derer Reinigungskräfte geschult und die Leistungsplanung erstellt werden können. Im nächsten Abschnitt werden die Menschen betrachtet, die diese Leistungen erbringen: Qualifikation, Personaleinsatz und Schulung der Reinigungskräfte.
Qualifikation, Personalplanung und Schulungskonzepte
Die Qualität der Krankenhausreinigung steht und fällt mit den Menschen, die sie ausführen. Reinigungskräfte im Krankenhaus benötigen ein besonderes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Fachwissen und Sorgfalt, da ihre Arbeit unmittelbaren Einfluss auf Hygiene und Patientensicherheit hat. Dieses Kapitel beleuchtet die notwendigen Qualifikationen, die Aspekte der Personalbedarfsplanung sowie Methoden der Schulung und Weiterbildung für Reinigungspersonal in Gesundheitseinrichtungen.
Berufsbild und Grundqualifikation
In Deutschland ist die Gebäudereinigung ein anerkannter Ausbildungsberuf (3-jährige Lehre zur/zum Gebäudereiniger/in). Allerdings verfügen nicht alle in Krankenhäusern eingesetzten Reinigungskräfte über diese Ausbildung. Vielfach werden Hilfskräfte oder Quereinsteiger beschäftigt, die keine formale Ausbildung haben, aber angelernt werden. Gerade in ausgelagerten Cleaning-Services wird aus Kostengründen häufig auf Kräfte ohne Gesellenbrief zurückgegriffen. Dennoch ist es unerlässlich, dass auch ungelerntes Personal eine Grundqualifikation in Hygienereinigung erlangt. Einige Bildungsträger und die Berufsgenossenschaft (BGW) bieten Kurzlehrgänge oder Zertifikatskurse an, z.B. „Fachkraft für Krankenhausreinigung“ oder Hygieneschulungen gemäß TRBA 250.
Wesentliche Inhalte einer solchen Qualifikation sind: Grundlagen der Hygiene (Keimkunde, Infektionswege), Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Umgang mit Reinigungsmitteln und -geräten, Arbeitssicherheit und PSA, sowie Krankenhaus-spezifische Abläufe (z.B. Reinigen in Patientenzimmern in Anwesenheit von Patienten, Verhalten in Isolationsbereichen). Speziell geschult werden muss der richtige Einsatz von Desinfektionsmitteln (Konzentration, Einwirkzeit – hier passieren in der Praxis oft Fehler) und die Vermeidung von Kreuzkontamination (z.B. strikte Trennung von „rein“ und „unrein“, Wechsel der Wischtücher zwischen Zimmern etc.).
Bei der Personalauswahl sollte darauf geachtet werden, dass Reinigungskräfte körperlich belastbar (viel Stehen, Bücken, Tragen), zuverlässig und teamfähig sind. Gute Deutschkenntnisse sind von Vorteil, um schriftliche Hygieneanweisungen und Sicherheitsunterweisungen zu verstehen – in der Realität haben jedoch viele Reinigungskräfte Migrationshintergrund und sprechen nur eingeschränkt Deutsch. Hier greifen die in Kap. 2 erwähnten Maßnahmen: vermehrter Einsatz von Bildern und Symbolen in Arbeitsanweisungen, um Sprachhürden zu überwinden.
Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erfolgt meist „on the job“ durch erfahrene Kollegen oder Vorarbeiter. Ein systematischer Einarbeitungsplan umfasst z.B.: Vorstellen der wichtigsten Hygieneregeln des Hauses, Rundgang durch die Bereiche, Demonstration der Reinigungsverfahren je Raumtyp, Erklärung der Reinigungsmittel (inkl. Dosiersysteme) und Gefahrenstoff-Unterweisung (Sicherheitsdatenblätter, was tun bei Chemikalienkontakt etc.). In den ersten Wochen sollte ein Mentor (Vorarbeiter) die Arbeiten der neuen Kraft begleiten und korrigierend eingreifen, bis Sicherheit erreicht ist.
Personalbedarf und Einsatzplanung
Die Personalplanung für den Reinigungsdienst ist eine anspruchsvolle managementtechnische Aufgabe. Es gilt, genügend Personal vorzuhalten, um das definierte Reinigungspensum (alle Bereiche gemäß Reinigungsplan) zuverlässig abzudecken – unter Berücksichtigung von Urlaub, Krankheitsausfällen und Schwankungen (z.B. erhöhter Reinigungsaufwand in Grippezeiten).
Der Personalbedarf wird meist auf Basis von Leistungskennzahlen ermittelt: wieviel Fläche oder wie viele Räume schafft eine Reinigungskraft pro Stunde unter den gegebenen Bedingungen? Dabei spielen viele Faktoren hinein (Verschmutzungsgrad, Möblierungsdichte, Reinigungsart, Wegezeiten etc.), sodass starre Kennzahlen vorsichtig zu nutzen sind. Extrem hohe Vorgaben (z.B. eine einzelne Kraft soll 500 m² Station in einer Stunde reinigen) sind ein Warnsignal – sie ermöglichen keine ausreichende hygienische Reinigung.
Branchenübliche Richtwerte liegen z.B. bei etwa 150–250 m²/h auf Normalstation (inkl. Zimmer und Flure) und deutlich weniger in stark möblierten oder infektionskritischen Bereichen (Intensiv z.B. 60–150 m²/h; OP-Saal Grundreinigung evtl. nur 50–100 m²/h). Eine DGKH-Umfrage ergab mediane Flächenleistungen von ca. 175 m²/h für Patientenzimmer, ~150 m²/h auf Intensivstation, ~70 m²/h im OP und ~325 m²/h auf Fluren. Diese Zahlen zeigen die Spannbreite und dienen der Orientierung.
Branchenübliche Richtwerte liegen z.B. bei etwa 150–250 m²/h auf Normalstation (inkl. Zimmer und Flure) und deutlich weniger in stark möblierten oder infektionskritischen Bereichen (Intensiv z.B. 60–150 m²/h; OP-Saal Grundreinigung evtl. nur 50–100 m²/h). Eine DGKH-Umfrage ergab mediane Flächenleistungen von ca. 175 m²/h für Patientenzimmer, ~150 m²/h auf Intensivstation, ~70 m²/h im OP und ~325 m²/h auf Fluren. Diese Zahlen zeigen die Spannbreite und dienen der Orientierung.
Die Dienstplangestaltung muss die genannten Schichten (Früh/Spät/Nacht) und Wochentage abdecken. Oft wird mit Teilzeitkräften gearbeitet, insbesondere für Frühdienste ein paar Stunden (viele Reinigungskräfte sind z.B. Frauen in Teilzeitbeschäftigung). Das erfordert eine akribische Planung, um Übergaben zu regeln und sicherzustellen, dass keine Lücken entstehen (z.B. nachmittags, wenn ein Unfall passiert und gereinigt werden muss). Einige Häuser haben daher Springer oder einen „Pool“, der flexibel einspringt.
Ein weiterer Aspekt ist die Planung fester Zuständigkeiten vs. Rotationspläne. Wie in Kap. 3 erwähnt, sind feste Stationsreiniger aus Qualitätsgründen wünschenswert. Wenn das Personal knapp ist, wird aber häufig rotiert oder nach Reinigungsarten aufgeteilt (Team A macht alle Patientenzimmer, Team B die Flure). In jedem Fall sollte es schriftliche Reinigungspläne pro Bereich geben, aus denen hervorgeht, wer was wann reinigt. Diese Pläne werden idealerweise auch den Stationen kommuniziert (Aushang oder im Intranet), damit das Pflegepersonal weiß, wann Reinigung zu erwarten ist.
Nicht zu vernachlässigen ist die Planung von Sonderreinigungen: z.B. Grundreinigungen von Fußböden (Bodenbeschichtungen erneuern, gründliche Eckenreinigung) oder Fensterreinigung. Diese erfolgen in größeren Abständen (mehrere Monate bis jährlich) und werden oft separat geplant, teils auch an Spezialfirmen vergeben. Das Stammpersonal muss dafür disponiert oder entlastet werden.
Schließlich muss man Urlaubs- und Krankheitsvertretungen einplanen. Eine typische Größe ist, etwa 10–15 % Reserve einzuplanen, was in der Praxis selten voll vorhanden ist. Bei Personalausfall wird oft auf Mehrarbeit anderer Kräfte oder Notlösungen (Pflege übernimmt interimistisch kleine Reinigungsaufgaben) zurückgegriffen – was aber aus Qualitäts- und Überlastungsgründen kritisch ist.
Schulung und Fortbildungskonzepte
Schulung ist ein zentrales Element, um eine gleichbleibend hohe Reinigungsqualität sicherzustellen. DIN 13063 betont die Pflicht zu regelmäßigen Mitarbeiterschulungen und Erfolgskontrollen. Schulungen lassen sich unterteilen in Grundschulungen (bei Einstellung oder bei Einführung neuer Verfahren) und Wiederholungsschulungen (z.B. jährliche Auffrischung).
Inhalte einer Grundschulung umfassen:
Hygiene-Basics: Warum ist Reinigung so wichtig? Übertragungswege von Keimen, Beispiele von Ausbrüchen durch unzureichende Reinigung (Motivation schaffen).
Arbeitsschutz: Nutzung von PSA, Vermeidung von Nadelstichverletzungen (falls Umgang mit Abfällen), Hautschutz bei Reinigungschemikalien.
Reinigungschemie: Kenntnis der im Haus verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel, deren korrekte Dosierung und Einwirkzeiten. (Dosierhilfen und automatische Dosiergeräte sollten gezeigt und geübt werden – Fehldosierung kann Wirksamkeitsverlust bedeuten.)
Gerätekunde: Richtiger Umgang mit Reinigungswagen, Mopps, Scheuersaugmaschinen, Staubsaugern, etc. Wartung der Geräte (z.B. tägliches Reinigen der Maschinen, Laden der Akkus).
Reinigungsverfahren und -pläne: Step-by-Step Demonstration der Methoden (z.B. 8-faches Falten eines Wischtuchs für 8 saubere Wischseiten, systematisches Wischen von sauber nach schmutzig, von oben nach unten). Einüben der Reihenfolge: erst Oberflächen (die höher liegen), dann Sanitärbereich, zuletzt Boden – und dabei Farbcodierung der Lappen strikt beachten.
Besondere Situationen: Verhalten bei Verschütten infektiöser Materialien (Blut: sofort Desinfektionsmittel, Einwirkzeit, aufsaugen mit Einmaltuch, fachgerecht entsorgen), Vorgehen bei Isolationszimmern (z.B. erst am Schluss reinigen, separates Equipment verwenden, doppelte Tücher).
Kommunikation & Verhalten: Angemessenes Verhalten gegenüber Patienten (freundlich, Privatsphäre respektieren), Kommunikation mit Pflege (z.B. Anklopfen vor Betreten des Zimmers, Hinweise geben wenn Boden nass ist). Auch: Diskretion (z.B. Schweigepflicht – Reinigungskräfte bekommen intimste Dinge mit, sie müssen wissen, was sie nicht weitertragen dürfen).
Dokumentation: Falls gefordert, das korrekte Ausfüllen von Reinigungsnachweisen, Checklisten oder elektronischen Erfassungssystemen.
Praktische Übungen und Begehungen sollten Teil der Schulung sein. Etwa, dass neue Mitarbeiter unter Anleitung ein Patientenzimmer reinigen, während der Trainer Feedback gibt. Moderne Ansätze nutzen hier auch Video-Schulungen oder sogar Virtual Reality (VR), um das Personal in realistischen Szenarien zu schulen, ohne Patienten zu stören.
Fortbildungen sollten mindestens jährlich stattfinden (viele Krankenhaushygieniker fordern 1–2 Schulungen/Jahr für Reinigungskräfte). Themen könnten sein: Auffrischung der Hygieneregeln, neue Erkenntnisse (z.B. Umgang mit neuen Erregern wie SARS-CoV‑2 – in der Pandemie wurden vielerorts Sonderschulungen durchgeführt), Einführung neuer Produkte oder Geräte, Lessons Learned aus Qualitätssicherungsrunden (etwa häufige Fehler, die man abstellen will). Auch Erfahrungsaustausch kann Teil von Schulungen sein: Reinigungskräfte berichten von Problemen und entwickeln gemeinsam Lösungen (z.B. „Wie reinige ich schwer zugängliche Stellen unter schweren Geräten?“).
ine Herausforderung ist oft die Sprachvielfalt. In vielen Teams sprechen Mitarbeiter verschiedene Muttersprachen (Türkisch, Arabisch, Osteuropäisch usw.). Hier muss das Schulungsmaterial möglichst visuell und einfach sein. Einige Kliniken lassen Schulungsunterlagen in die häufigsten Sprachen übersetzen oder setzen zweisprachige Vorarbeiter ein, die bei Schulungen dolmetschen können.
Kontrolle des Schulungserfolgs: Dies kann über kleine Tests (Quizfragen nach der Schulung), über Praxisbeobachtungen (Vorarbeiter begleitet Mitarbeiter und checkt, ob er gemäß Schulung vorgeht) oder Kennzahlen (z.B. Zahl der Beanstandungen vor und nach Schulungsmaßnahmen) erfolgen. Die Dokumentation aller Schulungen (Thema, Teilnehmerliste) ist wichtig – teils fordern Auditoren oder Behörden solche Nachweise.
Zusätzlich zu allgemeinen Schulungen sollten Führungskräfte im Reinigungsdienst (Vorarbeiter, Objektleiter) weitergehende Qualifikation haben. Ideal ist, wenn z.B. ein Gebäudereiniger-Meister oder Hauswirtschaftsmeister den Dienst leitet. Falls nicht vorhanden, sollten zumindest Kurse zu Qualitätsmanagement, Mitarbeiterführung und Hygiene-Fachwissen besucht werden. Die DGKH bietet z.B. Seminare „Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten im Gesundheitswesen“ an, die für Leitungspersonal wertvoll sind.
Personalentwicklung und Motivation
Die Reinigungsbranche hat traditionell mit hoher Fluktuation zu kämpfen. Um dem entgegenzuwirken, müssen Krankenhäuser auch auf gute Arbeitsbedingungen und Perspektiven für Reinigungskräfte achten. Dazu gehört eine faire Entlohnung (ggf. Anbindung an Tarif oder Prämien für gute Leistung), humane Arbeitszeiten (z.B. möglichst Vermeidung von geteilten Diensten frühmorgens und spätabends, was sozial belastet), sowie ein kollegiales Arbeitsklima. Teambesprechungen im Reinigungsdienst, kleine Belohnungen (z.B. Mitarbeiter des Monats, gemeinsames Frühstück für das Team nach erfolgreich bestandener Qualitätsprüfung) können die Motivation stärken.
Ein oft übersehener Punkt: Gesundheitsförderung für Reinigungskräfte. Ihre Tätigkeit ist körperlich anspruchsvoll – Rückenschmerzen und Hautprobleme (durch Feuchtarbeit) sind häufig. Arbeitgeber sollten daher Maßnahmen anbieten: z.B. Rückenschule-Kurse, Bereitstellung von Hautschutzcremes und Schonhandschuhen, regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorge (Hautscreening, Impfangebote). Auch ergonomische Reinigungsgeräte (Tücher mit Haltern, höhenverstellbare Wischmopps, Transportwagen mit Rollen in guter Qualität) zählen hier zu.
Durch fortlaufende Schulung und wertschätzende Personalführung wird erreicht, dass Reinigungskräfte sich als Teil des großen Ganzen fühlen. Nur mit motiviertem, gut ausgebildetem Personal lassen sich die hohen Hygieneanforderungen erfüllen. In den nächsten Kapiteln – insbesondere zur Qualitätssicherung (Kap. 6) – wird deutlich werden, wie eng verknüpft Mensch und System sind: Ein noch so gutes Qualitätsmanagement nützt wenig, wenn die Basisqualifikation fehlt; umgekehrt kann engagiertes Personal so manche Systemschwäche ausgleichen.
Qualitätssicherung, Audits und Monitoringprozesse
Die Sicherstellung einer konstant hohen Reinigungsqualität im Krankenhaus erfordert systematische Qualitätssicherungs- und Monitoringprozesse. Angesichts des unsichtbaren Ziels (Keimreduktion) und der dezentralen Leistungserbringung (viele Räume, viele Mitarbeiter) ist ein mehrstufiges Kontrollsystem nötig, das von der direkten Sichtkontrolle bis zur übergeordneten Auditierung reicht. In diesem Kapitel werden die Instrumente und Methoden vorgestellt, mit denen Krankenhäuser die Effektivität ihrer Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen überwachen und kontinuierlich verbessern können.
Visuelle Kontrollen und Eigenkontrolle
Die einfachste und grundlegende Form der Qualitätskontrolle ist die visuelle Inspektion: Sind die Böden und Oberflächen sichtbar sauber? Wurden Abfälle entleert? Gibt es Staub in Ecken oder auf Mobiliar? Solche Kontrollen erfolgen idealerweise täglich durch das Reinigungspersonal selbst (Selbstkontrolle: jeder Mitarbeiter prüft nach getaner Arbeit noch einmal kritisch den Raum) und durch die Bereichsleitung (z.B. Vorarbeiter machen Rundgänge). Viele Reinigungskräfte nutzen Checklisten oder Raumkarten, auf denen sie abhaken, was erledigt wurde. Manche Kliniken legen sogar im Patientenzimmer Checkkarten aus, auf denen das Reinigungspersonal durch Unterschrift die Durchführung bestätigt – was sowohl Signalwirkung für Patienten hat als auch intern kontrollierbar ist.
Doch reine Sichtkontrolle hat Grenzen: Mikrobiologische Verunreinigungen sind nicht erkennbar, ebenso nicht fehlerhafte Desinfektionskonzentrationen. Daher ergänzen fortschrittliche Häuser visuelle Checks durch objektivierte Messverfahren.
Objektive Reinigungsüberprüfungen
Eine etablierte Methode ist der Abklatschtest oder die Wischprobe: Dabei wird mit einem sterilen Tupfer oder Abklatschplatte eine definierte Fläche (z.B. 10×10 cm) nach der Reinigung beprobt und im Labor auf Keime untersucht. Besonders auf Intensivstationen oder OPs kann stichprobenartig geprüft werden, ob die Flächendesinfektion wirksam war (z.B. kein Nachweis von Krankenhauskeimen auf einer Oberfläche). Allerdings sind solche mikrobiologischen Tests teuer und liefern erst nach Tagen Ergebnisse – daher werden sie nur selten routinemäßig eingesetzt, eher im Rahmen von Ausbruchsaufklärung oder Validierung neuer Verfahren.
Schnellere Ergebnisse liefert der ATP-Biolumineszenztest: Hierbei wird die Menge an Adenosintriphosphat (ATP), einem in allen Zellen vorkommenden Molekül, auf einer Oberfläche gemessen. Hohe ATP-Werte deuten auf organische Rückstände (und damit potentielle Mikroorganismen) hin. Mit tragbaren ATP-Messgeräten kann man in Sekunden feststellen, ob z.B. ein OP-Tisch nach Reinigung biologisch sauber ist. Viele Krankenhäuser nutzen ATP-Tests als internes Monitoring in sensiblen Bereichen. Wichtig ist, Grenzwerte festzulegen (z.B. <250 relative Lichteinheiten gilt als sauber) und im Positivfall nachzuschulen.
Eine weitere pragmatische Methode sind Fluoreszenzmarker-Tests: Dabei bringt man vor der Reinigung an verborgenen Stellen (z.B. Bettgestellunterseite, hintere Toilettenrand) einen speziellen unsichtbaren Testmarker auf. Nach der Reinigung wird mit UV-Lampe geprüft, ob der Marker entfernt wurde. Bleibt er sichtbar, wurde die Stelle nicht oder nicht gründlich gereinigt. Solche Tests werden oft unangekündigt vom Hygieneteam oder QM-Team durchgeführt, um die Reinigungsabdeckung zu prüfen. Sie sind ein hervorragendes Schulungswerkzeug – in einigen Studien stieg nach Feedback mittels Marker-Test die Reinigungsquote an kritischen Kontaktflächen deutlich.
DIN 13063 erwähnt explizit Prüf- und Messmethoden zur Überprüfung der Krankenhausreinigung als Bestandteil der Qualitätsanforderungen. Es wird empfohlen, ein Bündel an Verfahren einzusetzen und die Resultate zu dokumentieren.
Interne Audits und Begehungen
Neben punktuellen Tests sollten regelmäßige Audits stattfinden. Ein Audit ist eine systematische Überprüfung anhand eines Kriterienkatalogs. Beispielsweise kann ein Hygieneaudit quartalsweise stichprobenhaft verschiedene Stationen prüfen auf: Staubfreiheit hochliegender Flächen, Sauberkeit Sanitär, korrekte Lagerung der Reinigungsutensilien (Wischbezüge nicht verschmutzt liegen lassen, etc.), Anwesenheit von Reinigungsplänen, Feedback der Stationsleitung zur Zusammenarbeit. Auditteams bestehen oft aus der Hygienefachkraft, einem Vertreter der Hauswirtschaftsleitung und ggf. einem Mitglied der Hygienekommission. Befunde werden in einem Auditbericht festgehalten und mit der Reinigungsleitung besprochen. So ein Audit kann z.B. aufdecken, dass in einer Station konsequent die Bettgestelle von unten nicht gereinigt werden – was dann Schulungs- oder Personalzeitbedarf anzeigt.
Wichtig ist auch das Feedback der Nutzer (Pflege, Ärzte, Patienten). Viele Häuser führen Patientenzufriedenheitsbefragungen durch, in denen Sauberkeit ein Kriterium ist. Negative Rückmeldungen („Bad war schmutzig“, „Zimmerboden klebte“) sollten ausgewertet werden. Auch Pflegepersonal meldet informell oder in Teambesprechungen, wenn die Reinigungsqualität nicht stimmt. Es empfiehlt sich, ein Meldeformular für Reinigungsmängel einzuführen – sei es elektronisch (Ticketsystem) oder analog – damit Stationsleitungen Beobachtungen (z.B. „im Bad Raum 312 sind seit Tagen Kalkablagerungen“) an den Reinigungsdienst zurückspiegeln können. Solche Meldungen sollten systematisch erfasst und nachverfolgt werden.
Externe Audits und Zertifizierungen
Einige Krankenhäuser unterziehen ihren Reinigungsservice auch externen Prüfungen. Dies kann im Rahmen der Gesamthaus-Zertifizierung (z.B. KTQ – Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) geschehen, wo Reinigungsprozesse mit bewertet werden. Es gibt zudem externe Auditierungsangebote spezifisch für Reinigungsqualität, etwa durch die RAL-Gütegemeinschaft Gebäudereinigung. Unternehmen, die das RAL-GZ 902/903 haben, müssen sich regelmäßigen externen Kontrollen stellen, bei denen objektiv die Sauberkeit geprüft und das QM-System begutachtet wird. Krankenhäuser könnten in Verträgen mit Fremdfirmen festschreiben, dass der Dienstleister ein solches Gütezeichen vorweisen muss – was indirekt eine Qualitätsgarantie darstellt.
Auch ISO 9001-zertifizierte Reinigungsdienstleister haben ein dokumentiertes Qualitätsmanagement, das regelmäßig auditiert wird.
In Deutschland sind externe Audits in der Reinigung (noch) nicht flächendeckend verbreitet. Allerdings könnten z.B. Gesundheitsämter bei Hygieneinspektionen auch die Reinigung kritisch betrachten. Insbesondere nach IfSG § 36 kann die Behörde bei gehäuften Infektionen prüfen, ob Reinigungspläne eingehalten werden.
Kennzahlen und Monitoring
Erfüllungsgrad der Reinigungspläne: z.B. „Anteil planmäßiger Reinigungen, die tatsächlich durchgeführt wurden“ (sollte ~100 % sein, außer bei belegten Zimmern wo nicht gestört werden konnte).
Mängelquote: Anzahl der Beanstandungen pro 100 Reinigungen.
ATP-Befund-Quote: Anteil der Flächen, die einen ATP-Wert über dem Grenzwert haben.
Schulungserfüllung: % der Mitarbeiter, die die vorgeschriebenen Schulungen absolviert haben (Ziel 100 %).
Krankenstand im Reinigungsdienst: kann indirekt auf Überlastung hindeuten.
Patientenzufriedenheit Sauberkeit: aus Befragungen (Schulnoten-Skala Durchschnitt).
Diese Zahlen werden idealerweise monatlich oder quartalsweise erhoben und in einem Qualitätsbericht dargelegt. So lässt sich über die Zeit erkennen, ob Maßnahmen wirken (z.B. Schulung führte zu Rückgang der Mängelquote).
Diese Zahlen werden idealerweise monatlich oder quartalsweise erhoben und in einem Qualitätsbericht dargelegt. So lässt sich über die Zeit erkennen, ob Maßnahmen wirken (z.B. Schulung führte zu Rückgang der Mängelquote).
Auch Trendanalysen sind möglich: zum Beispiel höhere Beschwerdezahlen immer in Urlaubszeiten -> evtl. Vertretungspersonal nicht ausreichend eingewiesen. Oder steigende Keimfunde auf Böden im Winter -> evtl. Streugut und Salz werden hereingetragen, was Anpassung der Reinigungsmittel erfordert.
Korrekturmaßnahmen und kontinuierliche Verbesserung
Wesentlich ist, dass Qualitätssicherung nicht beim Messen stehenbleibt, sondern zu Korrekturmaßnahmen führt. Wenn z.B. Audits Schwachstellen aufzeigen, müssen Maßnahmenpläne erstellt werden: etwa „Beschaffung eines zusätzlichen Reinigungsautomaten für die Eingangshalle bis Datum X, um Reinigungsfrequenz bei Schlechtwetter zu erhöhen“ oder „Nachschulung aller Mitarbeiter zum Thema Sanitärreinigung bis Ende Q4“. Verantwortlichkeiten und Fristen sind festzulegen und nachzuhalten.
Ein Konzept aus der Industrie, das auch im Krankenhaus greift, ist PDCA (Plan-Do-Check-Act): Man plant Verbesserungen, setzt sie um, überprüft den Erfolg, und standardisiert dann die erfolgreiche Maßnahme. Beispielsweise könnte man pilotweise auf einer Station ein neues Farbcode-System (noch feinere Trennung der Lappen) einführen, dann via Marker-Tests (Check) schauen, ob weniger Kreuzkontamination auftritt, und bei Erfolg das System im ganzen Haus ausrollen.
Auch der Austausch mit externen Einrichtungen kann hilfreich sein. Manche Kliniken führen Benchmarking durch, vergleichen also ihre Kennzahlen zur Reinigung mit anderen Häusern (sofern Daten verfügbar). Dies kann zeigen, wo man steht (z.B. Personalschlüssel im Vergleich, Kosten pro m², Infektionsraten vs. Reinigungsaufwand).
Zudem bringen wissenschaftliche Studien immer wieder neue Erkenntnisse: z.B. welche Oberflächen in Patientenzimmern am häufigsten kontaminiert sind (sogenannte High-Touch-Flächen: Bettgitter, Lichtschalter, Nachttische etc.). Ein zeitgemäßes Reinigungs-QM reagiert darauf, indem es den Fokus auf diese Flächen legt (z.B. Checklisten mit besonders zu reinigenden Kontaktflächen einführt).
Zusammengefasst besteht die Qualitätssicherung in der Krankenhausreinigung aus einem Mix von Maßnahmen: tägliche Selbstkontrolle, regelmäßige interne Audits (visuell und mit Tests), Kennzahlenmonitoring und Feedbackschleifen sowie gegebenenfalls externe Prüfungen. Diese Mechanismen greifen ineinander. Ihre Bedeutung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn letztlich ist nur das, was kontrolliert und gemessen wird, auch dauerhaft verbessert. Eine hochqualitative Krankenhausreinigung führt nachweislich zu besserer Infektionsprävention und einem angenehmeren Umfeld – sie ist somit ein essentielles Qualitätsmerkmal der Einrichtung.
Wirtschaftlichkeit und Leistungsverzeichnisse
Krankenhäuser stehen unter erheblichem ökonomischem Druck, was auch die sogenannten „Sekundärleistungen“ wie Reinigung betrifft. Das Spannungsfeld zwischen hohen Hygienestandards und Kosteneffizienz ist ein zentrales Thema im Reinigungsmanagement. In diesem Kapitel werden die ökonomischen Aspekte der Krankenhausreinigung beleuchtet: Wie lässt sich die Reinigung wirtschaftlich gestalten, ohne die Qualität zu kompromittieren? Welche Bedeutung haben Leistungsverzeichnisse bei der Planung, Steuerung und Ausschreibung von Reinigungsleistungen? Und wie können Kosten und Nutzen – etwa in Form verhinderter Infektionen – ins Verhältnis gesetzt werden?
Kostenstruktur der Krankenhausreinigung
Die Kosten der Reinigung im Krankenhaus setzen sich im Wesentlichen aus Personalkosten (in der Regel 70–80 % der Gesamtkosten) und Sachkosten (Reinigungsmittel, -geräte, Wäsche, Abschreibungen auf Maschinen) zusammen. In Eigenregie getragen, schlagen die Reinigungskosten direkt im Budget des Krankenhauses zu Buche. Bei Fremdvergabe erscheinen sie als Dienstleistungsvertrag (monatliche Pauschale oder nach Leistungsumfang abgerechnet).
Im deutschen DRG-System werden Hygiene- und Reinigungskosten nur indirekt über die Fallpauschalen abgebildet; es gibt keine separate Vergütung dafür. Daher versuchen Kliniken verständlicherweise, diese Kostenposition effizient zu gestalten. Allerdings zeigen Kosten-Nutzen-Betrachtungen, dass Einsparungen bei der Reinigung teuer „erkauft“ sein können, wenn sie zu mehr Infektionen führen: Eine schwere nosokomiale Infektion (z.B. postoperative Wundinfektion) kann das Krankenhaus leicht 10.000 € und mehr kosten (durch verlängerte Liegedauer, Isolationsaufwand etc.). Studien deuten darauf hin, dass verbesserte Hygienemaßnahmen – inklusive intensiverer Reinigung – etliche Infektionen und damit Kosten einsparen können. Die Wirtschaftlichkeit sollte also nicht eindimensional als „billigste Reinigung“ verstanden werden, sondern als optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis. Sprich: mit vertretbarem Ressourceneinsatz das Maximum an Hygiene und Sauberkeit erzielen.
Leistungsverzeichnisse und Leistungsumfang
Raumart (z.B. Patientenzimmer Normalstation) – täglich: Boden feucht wischen, Möblierung oberflächlich abwischen, Sanitärbereiche reinigen und desinfizieren; wöchentlich: gründliche Staubentfernung oberhalb Schrank usw.
Raumart (OP-Saal) – täglich: Grundreinigung morgens, Wischdesinfektion nach jedem Eingriff, Endreinigung nach OP-Programm, 1× wöchentlich Wände bis 2 m Höhe abwischen.
Verkehrsflächen – z.B. Eingangshalle: 2× täglich Scheuersaugen bei Nässe, sonst 1× täglich; Treppenhaus: 3× wöchentlich feucht aufnehmen, Handläufe täglich wischen.
etc.
Ein solches fein granular aufgegliedertes LV ermöglicht es, den Arbeitsanfall zu quantifizieren. Oft werden dazu „Maßeinheiten“ im LV angegeben: z.B. Anzahl der Patientenzimmer: 300, Fläche gesamt: X m², Anzahl OP-Säle: 8 etc. Für jede Position kann der Zeitaufwand (und damit die Kosten) kalkuliert werden. Bei Fremdvergabe dient das LV den Bietern zur Angebotserstellung; intern kann es genutzt werden, um den Personalbedarf und Materialbedarf zu planen.
Ein weiteres wichtiges Element im LV sind Leistungsbeschreibungen und Standards. Z.B. wird definiert, was „Unterhaltsreinigung“ beinhaltet, was „grundreinigen“ bedeutet (z.B. Entfernung aller Beschichtungs- und Pflegemittelschichten bis auf den Bodenbelag). Auch Qualitätskriterien können einfließen (z.B. „nach Reinigung sichtfrei von Staub und Wassertropfen“). Einige LVe definieren Toleranzgrenzen: etwa maximal zulässige Staubmenge auf waagerechten Flächen (wobei das praktisch schwer zu messen ist).
In Bezug auf Desinfektionsleistungen muss das LV klar regeln, welche Bereiche routinemäßig desinfizierend gereinigt werden und welche nur bei Bedarf. Da Desinfektionsreinigung teurer (langsame Einwirkzeit, teurere Chemie) ist, hat dies erheblichen Kostenimpact. Deshalb stehen interne Diskussionen oft um Fragen wie „sollen Patientenzimmer generell mit Desinfektionsmittel gewischt werden oder nur bei MRSA etc.?“ – hier muss eine fachliche Abwägung und Absprache mit der Hygienekommission erfolgen. Viele Kliniken haben heute entschieden, zumindest in sensiblen Bereichen oder bei Aufnahme-/Entlassreinigung immer ein Desinfektionsmittel einzusetzen. Die wirtschaftliche Seite ist dabei: Desinfektionsmittel sind teurer als neutrale Reiniger und können Oberflächenmaterialien stärker beanspruchen (häufigeres Nachwachsen/Pflegen nötig).
Zeit- und Personalressourcen optimieren
Objektanalyse und Arbeitsorganisation verbessern: Durch Arbeitsstudien („time & motion“ Analysen) kann man identifizieren, wo Zeit verloren geht. Z.B. könnte eine bessere Lage der Reinigungsdepots auf Station (kürzere Wege zum Nachfüllen von Wasser/Chemie) viel Zeit sparen. Auch „Clustering“ von Aufgaben: dass eine Kraft nacheinander alle Zimmer auf einer Seite reinigt statt hin- und herzugehen.
Mechanisierung: Der Einsatz von Reinigungsmaschinen kann Personalarbeit ersetzen oder beschleunigen. Beispiel: Ein automatischer Scheuersaugroboter kann nachts die langen Flure reinigen, während tagsüber weniger Personal nötig ist – und die Mitarbeiter können sich auf Detailreinigungen konzentrieren. Maschinelle Reinigungsgeräte (z.B. Einscheibenmaschinen für große Saalflächen, Dampfreiniger für hartnäckige Beläge) erhöhen häufig die Effizienz um ein Mehrfaches. Allerdings bedeuten Maschinen Anschaffungskosten und Wartung; eine Wirtschaftlichkeitsrechnung (ROI) ist vorab sinnvoll.
Teamgröße anpassen: In großen OP-Bereichen arbeiten oft Teams von 2–3 Reinigungskräften gemeinsam, weil die Flächen rasch fertig sein müssen (Zeitfenster zwischen OPs). In anderen Bereichen kann 1 Person alleine arbeiten. Die Aufteilung der Mitarbeiter auf Stationen sollte so gestaltet sein, dass Leerlauf minimiert wird – z.B. kann eine Kraft, die ihre Station vorzeitig fertig hat, noch in einer anderen aushelfen. Hier ist der Spagat, keine Unterbesetzung (Qualitätsrisiko) aber auch keine dauerhaften Überkapazitäten zu haben.
Multitasking und Zusammenlegung von Aufgaben: In manchen Krankenhäusern werden Reinigungskräfte auch mit nebenliegenden Aufgaben betraut, etwa Bettenaufbereitung (Bettenreinigung beim Patientenwechsel) oder Hol- und Bringdienste, falls ihr Hauptpensum erledigt ist. Dies steigert die Auslastung. Allerdings darf dies nicht zulasten der eigentlichen Reinigungsqualität gehen – man muss aufpassen, Reinigungskräfte nicht zu „Mädchen für alles“ zu machen, da sonst Kernaufgaben leiden.
Outsourcing gezielt nutzen: Manche Spezialreinigungen (Fenster, Fassade, Hochglanzböden Kristallisieren etc.) werden an Fachfirmen gegeben, weil sie für interne Kräfte zeitaufwendig und selten sind. So kann teures Equipment (Hebebühne für Fenster z.B.) und Zeit gespart werden.
Einsatz moderner Hilfsmittel: Beispielsweise vorgefertigte Wischbezüge (in Desinfektionslösung getränkt und in Boxen bereitgestellt) können Zeit sparen, da die Mitarbeiter nicht mehr vor Ort ansetzen mischen müssen und für jeden Raum ein frisches Tuch griffbereit haben. Solche Systeme erhöhen auch die Reinigungssicherheit, da Dosierfehler vermieden werden. Allerdings kosten sie in der Vorbereitung (oft zentral in der Wäscherei) etwas mehr.
Auf der Materialseite lässt sich ebenfalls sparen, aber vorsichtig: Konzentratdosierungssysteme stellen sicher, dass nicht überdosiert wird – dies spart Chemie und Geld und schont die Umwelt. Großgebinde sind günstiger als viele kleine Packungen, aber unhandlich – hier wählt man oft einen Mittelweg (z.B. Kanister in Putzkammer, kleine Dosierflasche auf dem Wagen). Bei Verbrauchsmaterial (Einmaltücher, Mopbezüge) hat die Entscheidung „Einweg vs. Mehrweg“ nicht nur hygienische, sondern auch wirtschaftliche Aspekte: Mehrwegtextilien kosten in der Anschaffung mehr, benötigen Waschen (Kosten in Wäscherei), halten aber lange; Einweg kostet kontinuierlich (Nachkauf) und erzeugt mehr Abfall. Viele Kliniken machen hier Mixed-Ansätze: z.B. Microfasermopps für Normalbereiche, aber Einwegmopps in Isolationsbereichen.
Ausschreibungen und Vertragsgestaltung
Für öffentliche Krankenhäuser besteht ab gewissen Volumina Vergabepflicht, d.h. Reinigungsleistungen müssen EU-weit ausgeschrieben werden. Ein gutes Leistungsverzeichnis ist hier die Grundlage. In der Ausschreibung sollten neben dem reinen Preis auch Qualitätskriterien eingehen: z.B. Referenzen des Anbieters im Gesundheitswesen, vorhandene Zertifizierungen (RAL, ISO), Konzept für Qualitätssicherung, Vorschläge zur Personalqualifikation etc. So kann verhindert werden, dass nur der billigste, aber unqualifizierteste Anbieter zum Zuge kommt.
In den Verträgen mit Dienstleistern werden oft Pönalen (Vertragsstrafen) für Nicht-Einhaltung der Leistung vereinbart – z.B. wenn Audits wiederholt ungenügende Sauberkeit feststellen, kann das zur Zahlungsreduktion führen.
Umgekehrt sind Bonusregelungen möglich (etwa bei sehr guter Bewertung durch Patientenumfragen erhält Dienstleister einen Bonus). Eine klare Definition von Reaktionszeiten gehört auch hinein: z.B. „Notfälle (Blut/Erbrochenes) sind innerhalb von 10 Minuten aufzunehmen“ – damit der Dienstleister auch ausreichend Springerdienste bereithält.
Kalkulatorisch werden Reinigungsverträge teils auf Stundenbasis (nach tatsächlich geleisteten Stunden) oder pauschal pro m² abgerechnet. Der Trend geht zu Pauschalverträgen mit definiertem Leistungsumfang, da dies dem Krankenhaus Planungssicherheit gibt. Allerdings muss man hier das Leistungsvolumen genau kennen, sonst drohen entweder Mehrkosten durch Sondernachträge oder Qualitätsprobleme, wenn sich der Anbieter verkalkuliert hat.
Wirtschaftlichkeit vs. Hygiene – ein Balanceakt
Die Leistungsverdichtung in den letzten Jahren (mehr Fläche pro Kraft) hat häufig zu Frustration beim Personal und Qualitätsabfall geführt. So berichteten fast 60 % der befragten Hygienefachleute 2013 von einer Verschlechterung der Reinigung – was oft auf Sparmaßnahmen zurückzuführen war. Krankenhäuser müssen erkennen, dass Hygiene kein lästiger Kostenfaktor, sondern ein essentieller Teil der Leistungserbringung ist. Investitionen in bessere Reinigung zahlen sich mittel- und langfristig aus: durch weniger Infektionen, zufriedeneres Patientenfeedback (Sauberkeit ist oft ein zentrales Kriterium in Befragungen) und Werterhalt der Bausubstanz.
Ein praktischer Ansatz ist die integrierte Planung von Qualität und Kosten: Bereits beim Aufstellen des Reinigungsplans wird geschaut, wo man ggf. Abstriche machen kann, die keine Sicherheit kosten.
Beispiel: Fensterreinigung nur 2× statt 4× im Jahr; Tiefgaragenreinigung eher kosmetisch – kann man reduzieren. Aber Patientenzimmerreinigung darf nicht reduziert werden, da es sonst sofort hygienische Folgen hätte. Diese Priorisierung nach medizinischer Notwendigkeit gilt es, auch den Verwaltungschefs zu kommunizieren.
Zudem sollte man den Erfolg von Investitionen messen: Wenn z.B. eine zusätzliche Reinigungskraft für die Notaufnahme eingestellt wird, um dort häufiger desinfizierend zu reinigen, könnte man tracken, ob die Rate der Umgebungs-Kontamination oder der Norovirus-Ausbrüche zurückgeht. Solche Daten helfen, die Wirtschaftlichkeit von Hygieneinvestitionen zu untermauern.
Wirtschaftlichkeit in der Krankenhausreinigung bedeutet, mit den gegebenen Mitteln ein optimales Hygieneresultat zu erzielen. Das Leistungsverzeichnis ist das Herzstück der Planung und Kostenkalkulation. Realistische Leistungskennzahlen und klug gesetzte Prioritäten verhindern Überforderung des Personals und Qualitätsmängel. Die kontinuierliche Abstimmung zwischen Hygieneverantwortlichen und Kostenverantwortlichen ist nötig, damit Einsparungen nicht an der falschen Stelle passieren. Der berühmte Satz „Sauberkeit kostet Geld, aber mangelnde Sauberkeit kostet Leben“ soll Entscheidern stets bewusst sein – er erinnert daran, dass Patientensicherheit oberste Priorität hat und wirtschaftliche Überlegungen dem nicht entgegenstehen dürfen, sondern im Einklang damit gebracht werden müssen.
Nachhaltigkeit und Umweltwirkungen der Reinigung
Nachhaltigkeit spielt in allen Bereichen des Gesundheitswesens eine wachsende Rolle – so auch in der Reinigung. Unter Nachhaltigkeit versteht man hier ökologische Verträglichkeit, Ressourcenschonung und soziale Verantwortung bei der Planung und Durchführung von Reinigungsprozessen. Krankenhausreinigung und Umweltschutz stehen mitunter in einem Spannungsverhältnis: Einerseits hat Hygiene oberste Priorität, andererseits sind viele Reinigungs- und Desinfektionschemikalien potenziell umweltbelastend und die Reinigung verbraucht erhebliche Mengen an Ressourcen (Wasser, Energie, Einwegmaterialien). In diesem Kapitel werden Strategien vorgestellt, wie Sauberkeit und Hygiene mit Umweltverträglichkeit in Einklang gebracht werden können.
Auswahl umweltfreundlicher Reinigungsprodukte
Ein zentraler Hebel ist die Produktwahl. Moderne Reinigungsmittel sind zunehmend in ökologisch abbaubaren Formulierungen erhältlich – z.B. Tenside auf pflanzlicher Basis, Verzicht auf Phosphate, Chlor etc. Krankenhäuser können auf Produkte mit Umweltzeichen wie dem „Blauen Engel“ oder dem EU-Ecolabel zurückgreifen. Diese erfüllen bestimmte Auflagen bezüglich biologischer Abbaubarkeit und geringer Ökotoxizität. Insbesondere für Flächenreiniger in weniger kritischen Bereichen (Büros, Flure) sollte standardmäßig ein umweltzertifiziertes Produkt verwendet werden.
Bei Desinfektionsmitteln ist die Auswahl schwieriger, da hier Wirksamkeit gegen Erreger im Vordergrund steht.
Aber auch hier gibt es Entwicklungen: Sauerstoffabspalter (Peroxide) oder Alkohol-basierte Desinfektionsmittel sind in der Regel umweltverträglicher als z.B. Aldehyde oder quaternäre Ammoniumverbindungen, da sie rückstandsfrei abbauen (Wasser und Essigsäure/O2 bleiben übrig bei Peressigsäure). Das RKI fordert auch, Desinfektionswirkstoffe zu wählen, die „möglichst wenig Umweltbelastung“ verursachen, solange die Wirksamkeit gewährleistet ist. Beispielsweise kann man für Standardflächen statt eines aldehydischen Desinfektionsmittels ein alkoholisches Gebrauchsfertigtuch nehmen – Alkohol verfliegt ohne Rückstände, während Aldehyde in Abwässer gelangen können. Allerdings ist Alkohol hochentzündlich, was in großen Mengen zu beachten ist (Arbeitsschutz).
Dosiergenauigkeit trägt ebenfalls zur Nachhaltigkeit bei: Überdosierung von Chemie führt zu unnötiger Umweltbelastung. Automatische Dosiersysteme stellen sicher, dass genau die benötigte Menge Konzentrat ins Wischwasser kommt. Wo manuell dosiert wird, schulen viele Häuser „weniger ist mehr“ – z.B. ein Messbecher pro Eimer, nicht Pi mal Daumen.
Wasser- und Energieverbrauch
Krankenhausreinigung benötigt Wasser (Wischwasser, Mopwaschen) und Energie (Maschinen, Warmwasser, Trocknung). Zur Wassereinsparung setzt man auf Mopp-Vorpräparation und Zwei-Eimer-Methoden: Statt ständig Wasser zu wechseln, werden Mopps im Voraus mit exakt bemessener Lösung getränkt, was pro Raum vielleicht 0,5 L braucht statt beim klassischen Putzeimer evtl. 5 L für mehrere Zimmer. Das reduziert auch Abwasser. Einige Kliniken haben implementiert, dass Reinigungskräfte nur Kaltwasser nutzen, wo chemisch nicht unbedingt Warmwasser nötig ist – da Warmwasseraufbereitung Energie kostet. Moderne Reinigungsmaschinen (z.B. Scheuersaugmaschinen) arbeiten oft mit Sprühtechnik (sehr geringer Wasserausstoß) und Recycling (Schmutzwasser wird gefiltert und kann zum Teil wiederverwendet werden), was die Wassermenge ebenfalls drückt.
Bei der Wäsche von Reinigungstextilien (Mopps, Tücher) kann ein Krankenhaus große Hebel ansetzen: Wichtig ist das Laden der Maschinen entsprechend Füllmenge (keine halbleeren Waschgänge), Einsatz von energieeffizienten Waschmaschinen und Ökoprogrammen. Mopp-Waschmaschinen speziell für Mikrofasermaterial passen etwa die Wasserstände optimiert an. Zudem lässt sich überlegen, ob eine chemothermische Aufbereitung bei 60 °C mit geeigneten Desinfektionswaschmitteln ausreicht, anstatt alles bei 90 °C zu kochen – was Energie spart. Viele Desinfektionswaschmittel erlauben heute schon bei 60 °C oder sogar 40 °C keimtötende Wirkung. Hier müssen Hygiene und Umweltschutz abgewogen werden, aber oft sind niedrigere Temperaturen ausreichend, solange Produkte VAH-gelistet sind.
Stromverbrauch der Reinigungsmaschinen (Staubsauger, Scrubber) kann mit energiesparenden Geräten reduziert werden. Beim Kauf sollte auf Energieeffizienz geachtet werden, z.B. neue Staubsauger mit sparsamem Motor. Manche Maschinen laden Batterien in Zwischentaktung, um Spitzen zu vermeiden (peak shaving). Auch Timer können genutzt werden: etwa, dass Reinigungsräume beheizt sind nur tagsüber, nachts abgesenkt – das fällt auch in den Bereich Nachhaltigkeit.
Abfallmanagement und Mehrweg/Einweg-Abwägung
Abfallvermeidung ist ein Nachhaltigkeitsziel. In der Reinigung fallen Abfälle an durch Einmalartikel (Wischtücher, Wegwerfmopps, Verpackungen von Reinigungsmitteln). Viele Kliniken versuchen, den Einmalverbrauch auf das Nötige zu beschränken: Mikrofasertücher und Mopps werden meist als Mehrweg eingesetzt und in der hauseigenen Wäscherei zigfach wiederaufbereitet. Nur in Ausnahmefällen (Hochisolationspatienten, bestimmte Infektionserreger) werden Einwegmaterialien verwendet und anschließend sicher entsorgt.
Selbst bei Mehrweg entstehen jedoch Abwässer mit Chemikalien und Mikroplastik (aus Mikrofasern lösen sich Kunststofffasern beim Waschen). Hier kann man gegensteuern, indem man hochwertigere, weniger flusende Textilien verwendet und evtl. Filter in Waschmaschinen einsetzt, die Mikroplastikpartikel auffangen (es gibt Spezialfilter für Wäschereien diesbezüglich).
Verpackungsmüll lässt sich reduzieren, indem man Reinigungsmittel in Konzentratform in Großgebinden bezieht (Kanister statt vieler kleiner Flaschen) und vor Ort in wiederbefüllbare Sprühflaschen umfüllt. Einige Hersteller bieten sogenannte Bag-in-Box-Systeme oder Kanister-Refillstationen, die Verpackungsabfall deutlich verringern.
Wo möglich, kann auch auf Papierhandtücher vs. Warmlufttrockner im Reinigungskontext geschaut werden – allerdings gilt aus Hygienegründen in Kliniktoiletten Einmalhandtuch als Standard, Warmlufttrockner sind weniger hygienisch. Dennoch: es gibt z.B. Recycling-Papierhandtücher, die aus Altpapier hergestellt sind und mit Umweltzeichen versehen. Deren Nutzung anstelle von Frischfaserpapier trägt zur Ressourcenschonung bei.
Innovative umweltschonende Verfahren
Reinigung nur mit Wasser (Mikrofaser): Hochwertige Mikrofasertücher können Schmutz mechanisch entfernen, oft auch einen Großteil von Keimen, ohne Reinigungsmittel. Für viele Flächen reicht mikrofaserbasierte Feuchtreinigung. In Bereichen, wo keine Desinfektion erforderlich ist, kann man so chemiefrei reinigen (bspw. Büros, Fenster).
Ozonisiertes oder elektolytisch aktiviertes Wasser: Geräte können Leitungswasser in einen kurzzeitig wirksamen Reiniger umwandeln (Ozon oder hypochlorige Säure mittels Elektrolyse). Dieses Wasser hat eine gewisse desinfizierende Wirkung, zerfällt aber rasch wieder in normales Wasser ohne Rückstände. Einige Kliniken (Pilotprojekte) nutzen solche Systeme für Böden, um auf konventionelle Reiniger zu verzichten. Studien laufen, inwiefern die Reinigungsleistung vergleichbar ist. Vorteil wäre: kein Chemikalientransport, keine Rückstände im Abwasser.
Trockendampf-Reinigung: Dampfreiniger können mit sehr heißem Dampf (ca. 170 °C an der Düse) Schmutz lösen und Keime abtöten, ganz ohne Chemie. Für Nischen (Fugen, Ecken, Sanitär) ist das hervorragend. Allerdings sind Dampfreiniger energielastig (Strom) und können nicht auf allen Oberflächen eingesetzt werden (empfindliche Materialien). Dennoch kann man punktuell damit Reinigungsmittel einsparen (z.B. bei der Grundreinigung von Duschbereichen statt stark saurer Reiniger gegen Kalk).
Nano-Beschichtungen: In manchen Krankenhäusern experimentiert man mit Beschichtungen auf Oberflächen (z.B. auf Türgriffen, Bettgestellen), die antimikrobiell wirken oder Schmutz abweisend sind. Zum Beispiel Titanoxid-Beschichtungen, die unter Licht Keime abtöten (photokatalytisch), oder Silberbeschichtungen. Wenn solche Beschichtungen funktionieren, könnten sie die erforderliche Reinigungsfrequenz reduzieren oder weniger Chemie nötig machen. Aber es ist wichtig zu betonen, dass sie Reinigung nie ersetzen – allenfalls unterstützen.
Dosierhilfen und Sensorik: Manche Reinigungswagen sind heute mit digitalen Dosiermodulen ausgestattet, die exakt Wasser und Chemie mischen – kein Überlaufen, kein Zuviel. Auch gibt es Sensoren, die z.B. den Füllstand von Handtuch- und Seifenspendern überwachen (IoT-Technologie). Dadurch müssen Reinigungskräfte nicht prophylaktisch halbleere Spender austauschen (was Reste verschwendet), sondern nur bei Bedarf. Das reduziert den Verbrauch und Abfall (angefangene Rollen etc.).
Soziale Nachhaltigkeit
Neben der ökologischen Dimension gehört zur Nachhaltigkeit auch das Soziale: Hier ist insbesondere die faire Behandlung und Entlohnung des Reinigungspersonals zu nennen. Nachhaltiges Facility Management achtet darauf, keine „Ausbeutung“ zu betreiben – also angemessene Löhne, humane Arbeitszeiten (siehe Kap. 5). Denn nur wenn der Beruf attraktiv und die Mitarbeitergesundheit geschützt ist, bleibt die Dienstleistung langfristig tragfähig. Zudem engagieren sich einige Krankenhäuser in Integrations- und Inklusionsprojekten: z.B. werden in der Reinigung bewusst Mitarbeiter mit Handicap oder aus schwierigen sozialen Verhältnissen beschäftigt und gefördert. Dies kann man als Teil der sozialen Nachhaltigkeit sehen.
Umweltmanagement und Zertifizierungen
Krankenhäuser können Umweltmanagementsysteme wie ISO 14001 oder EMAS einführen, worin auch die Reinigung integriert wird. Dabei werden z.B. jährliche Umweltziele gesetzt – etwa „Verbrauch an Reinigungschemie um 5 % reduzieren“ oder „Abwasserbelastung durch Desinfektionsmittel XY minimieren“. Solche Ziele zwingen zum Monitoring und Nachsteuern. Einige Kliniken veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte, die auch Kennzahlen enthalten wie Liter Reinigungsmittel pro 100 m² und Jahr oder CO₂-Fußabdruck der Reinigu
